Unterschiedlich, doch ähnlich – Die Wahrheit liegt immer dazwischen
Zwischen Klischees und Gemeinplätzen ist es oft schwierig oder nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten: Was charakterisiert einen Italiener und einen Deutschen tatsächlich? Wo liegen die kulturellen Unterschiede? Was ist richtig und was falsch? Ist alles nur Hörensagen und Gerede? Ist es wissenschaftlich belegt, dass das eine Volk das „Geordnete“ bevorzugt und das andere südlich der Alpen das „Chaotische“? Ist das alles nur Unfug, oder verbirgt sich doch ein Stück Wahrheit irgendwo zwischen Flensburg und München oder zwischen Domodossola und Lampedusa?

Über die Kulturunterschiede und -gemeinsamkeiten zwischen Italien und Deutschland
Zwischen Klischees und Gemeinplätzen ist es oft schwierig oder nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten: Was charakterisiert einen Italiener und einen Deutschen tatsächlich? Wo liegen die kulturellen Unterschiede? Was ist richtig und was falsch? Ist alles nur Hörensagen und Gerede? Ist es wissenschaftlich belegt, dass das eine Volk das „Geordnete“ bevorzugt und das andere südlich der Alpen das „Chaotische“? Ist das alles nur Unfug, oder verbirgt sich doch ein Stück Wahrheit irgendwo zwischen Flensburg und München oder zwischen Domodossola und Lampedusa?
Es sind viele Fragen, die nicht unbedingt in einem einzigen Blogbeitrag ausführlich beantwortet werden können. Was jedoch höchstwahrscheinlich stimmt, ist, dass sich gewisse Grundtendenzen bei beiden Kulturkreisen abzeichnen und diese dadurch als „wahr“ oder „hochwahrscheinlich” betrachtet werden könnten.
Es gibt in den Kulturwissenschaften zwei Fachbegriffe, die uns bei diesem heiklen Thema ein wenig den Durchblick verschaffen: Low-Context-Kulturen und High-Context-Kulturen.
Mülltrennung in Deutschland

Mülltrennung in Italien

Laut Kulturwissenschaftlern gehört Italien zu den High-Context-Kulturen, während Deutschland eher zu den Low-Context-Kulturen zählt.
Nach Edward T. Halls Theorie zur High-Context- und Low-Context-Kommunikation:
- Deutschland wird typischerweise als Low-Context-Kultur betrachtet. Das bedeutet, dass die Kommunikation in Deutschland direkter und expliziter ist, und der Fokus auf klaren, präzisen und gut strukturierten Informationen liegt. Menschen in Low-Context-Kulturen verlassen sich eher auf das gesprochene oder geschriebene Wort, um Informationen zu vermitteln, da der Kontext, also die Beziehung oder der Hintergrund, weniger eine Rolle spielt.
- Italien hingegen wird eher als High-Context-Kultur eingestuft. In High-Context-Kulturen ist der Kontext, in dem die Kommunikation stattfindet, sehr wichtig. Ein Großteil der Informationen wird indirekt durch Gesten, Tonfall, Mimik oder durch das Wissen um die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern übermittelt.
Diese Unterschiede führen dazu, dass Deutsche oft als sehr direkt und sachlich wahrgenommen werden, während Italiener in ihrer Kommunikation mehr subtile, kontextuelle Hinweise nutzen, was auch nonverbale Kommunikation miteinschließt.
Eine treffende Interpretation der Unterschiede zwischen Low-Context-Kulturen (wie Deutschland) und High-Context-Kulturen (wie Italien) ist folgende Anekdote:
Der deutsche Geschäftspartner bevorzugt in der Regel, dass geschäftliche Angelegenheiten formell und während der Arbeitszeit geklärt werden. Dabei liegt der Fokus auf Effizienz, klaren Informationen und strukturierten Verhandlungen, die sich auf das Wesentliche konzentrieren – typisch für eine Low-Context-Kultur, wo der Inhalt des Gesprächs wichtiger ist als der soziale Kontext.
Der italienische Geschäftspartner hingegen könnte es bevorzugen, den Deal in einer informellen Umgebung zu besprechen, z.B. bei einem Abendessen nach Feierabend. Hier spielt der persönliche Beziehungsaufbau eine wichtige Rolle, was typisch für eine High-Context-Kultur ist. In solchen Kulturen ist es oft üblich, dass der soziale Rahmen und die persönliche Beziehung zur Verhandlung und zum Deal ebenso wichtig oder sogar entscheidender sind als die rein sachlichen Argumente.
Dieser Unterschied kann zu Missverständnissen führen, wenn die jeweiligen kulturellen Präferenzen nicht verstanden werden. Während der Deutsche den Fokus auf schnelle, effiziente Entscheidungen legt, möchte der Italiener möglicherweise erst eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, bevor er zu einem formellen Abschluss kommt.
Kann das Verständnis für unser Gegenüber sowie die Anerkennung kultureller Unterschiede der Schlüssel sein, der die Pforte zu einem anderen Kulturkreis öffnet? Wie viel „Fremde” steckt in uns, um ein besseres und reibungsloses Miteinander zu ermöglichen?
Wie viel „Eigenes“ steckt in uns, um uns von dem „Anderen” abzuheben? Um das „Andere“ zu verstehen, muss man das „Eigene“ wahrnehmen, verstehen, schätzen und mögen.
Die Beziehung zwischen dem „Eigenen” und dem „Anderen” ist ein zentrales Thema in der interkulturellen Kommunikation. Es geht darum, wie wir unsere eigene Identität wahrnehmen und wie diese Wahrnehmung unsere Interaktion mit anderen Kulturen beeinflusst.
Offenheit für das „Andere“: Das „Andere“ zu verstehen erfordert Neugierde und Offenheit. Es bedeutet, aktiv auf Menschen aus anderen Kulturen zuzugehen, ihre Geschichten zu hören und ihre Perspektiven ernst zu nehmen. Dabei sollten wir uns bewusst sein, dass unsere eigene Sichtweise nicht die einzig gültige ist. Jede Kultur hat ihre eigenen Werte, Traditionen und Ausdrucksformen, die es zu entdecken gilt.
Der Austausch mit dem „Anderen“ ist keine Einbahnstraße. Während wir lernen, andere Kulturen zu verstehen, erweitern wir auch unseren eigenen Horizont. Neue Erfahrungen und Erkenntnisse können uns inspirieren und persönliche Weiterentwicklung fördern. Dieser Prozess bereichert nicht nur unser Wissen, sondern auch unsere Empathie und Kommunikationsfähigkeit.
Ein wichtiger Aspekt ist, die Balance zwischen dem Bewahren der eigenen Identität und der Anpassung an neue kulturelle Kontexte zu finden. Es geht nicht darum, das „Eigene” aufzugeben, sondern es als Teil eines größeren Mosaiks zu sehen. Indem wir uns auf das „Andere” einlassen, ohne uns selbst zu verlieren, fördern wir gegenseitigen Respekt und Verständnis.
Gemeinsamkeiten entdecken: Oftmals fokussieren wir uns auf die Unterschiede zwischen Kulturen, doch genauso wichtig ist es, die Gemeinsamkeiten zu erkennen. Menschliche Grundbedürfnisse wie Freundschaft, Liebe und Sicherheit sind universell. Das Bewusstsein dafür kann Brücken bauen und helfen, kulturelle Barrieren zu überwinden.
Eine sehr wichtige und zum Nachdenken anregende Frage ist:
Ist es nicht besser, sich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren?
Sich auf Gemeinsamkeiten zu fokussieren kann tatsächlich helfen, Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu bauen. Wenn wir erkennen, dass wir trotz unterschiedlicher Hintergründe viele ähnliche Werte, Bedürfnisse und Wünsche teilen, kann das die Kommunikation und Zusammenarbeit erheblich verbessern.
Wichtig ist dabei, Folgendes nicht aus den Augen zu verlieren: Es ist wichtig, die kulturellen Unterschiede nicht zu ignorieren. Diese Unterschiede prägen unsere Perspektiven, Verhaltensweisen und Kommunikationsstile. Wenn wir uns ausschließlich auf Gemeinsamkeiten konzentrieren und die Unterschiede außer Acht lassen, besteht die Gefahr von Missverständnissen und Konflikten. Ohne das Bewusstsein für kulturelle Unterschiede könnten wir unbewusst Erwartungen und Normen auf andere projizieren, die in deren Kultur nicht gelten.
Urlaub in Deutschland

Urlaub in Italien
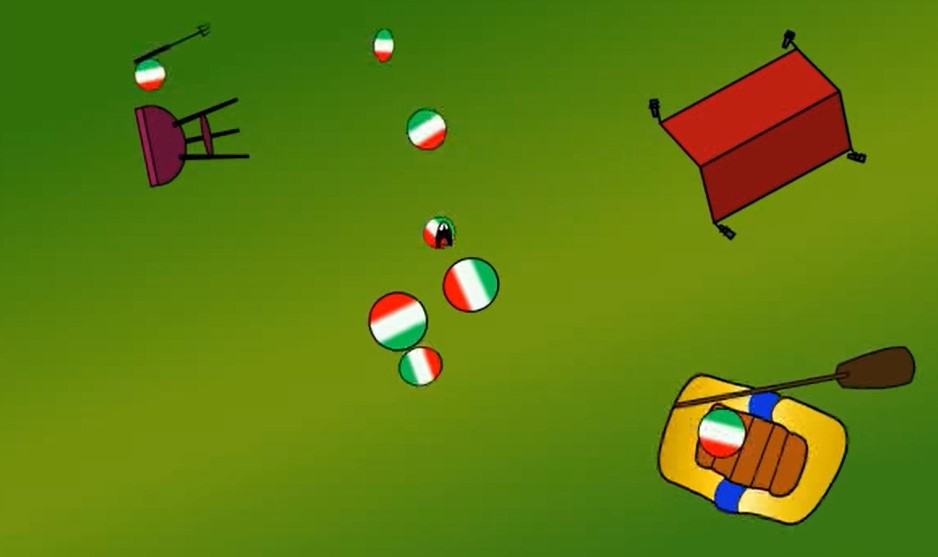
Wenn man versteht, dass eine muslimische Haushaltshilfe bei einer Temperatur von 37 °C einen leichten, langärmligen Pullover trägt und die Ärmel nicht hochkrempelt, weil das Zeigen ihrer Arme nicht mit ihren religiösen Überzeugungen vereinbar ist, erübrigen sich weitere Nachfragen.
Wenn ein Italiener nicht nachvollziehen kann, dass es in Deutschland nicht durchgehend üblich ist, in Restaurants Tischdecken zu verwenden, sollte er sich mit dieser kulturellen Gegebenheit auseinandersetzen.
Wenn ein Deutscher nicht nachvollziehen kann, dass Warteschlangen an einer Theke oder einem Schalter in Italien sehr unstrukturierte und „flexible” Formen annehmen und alles andere als eine geordnete Reihe darstellen können, sollte er sich mit dieser kulturellen Gegebenheit auseinandersetzen.
Statt uns nur auf Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zu fokussieren, ist es sinnvoll, beides zu kombinieren. Gemeinsamkeiten bringen uns zusammen und bilden eine Grundlage für Beziehungen. Wenn wir aber auch die Unterschiede verstehen, können wir respektvoll und gut miteinander umgehen. Diese ausgewogene Herangehensweise hilft uns, andere Kulturen besser zu verstehen und trägt dazu bei, dass wir in unserer vielfältigen Welt harmonisch zusammenleben.
Hier ist eine Liste der genannten Forscherinnen und Forscher mit ihren jeweiligen Nationalitäten, die als Inspiration für diesen Blogbeitrag dienten:
- Edward T. Hall (Amerikaner)
Bekannt für seine Theorien zur Proxemik (Raumnutzung) und die Unterscheidung zwischen High-Context- und Low-Context-Kulturen. - Geert Hofstede (Niederländer)
Berühmt für sein Modell der Kulturdimensionen, darunter Unsicherheitsvermeidung, Machtdistanz, Individualismus vs. Kollektivismus und andere Dimensionen der interkulturellen Kommunikation. - Fons Trompenaars (Niederländer)
Entwickelte das Modell von Kulturdimensionen und interkulturellen Unterschieden, das auf Geschäfts- und Managementkontexte abzielt, ähnlich wie das Modell von Hofstede. - Penelope Brown und Stephen Levinson – Britin (Brown) und Amerikaner (Levinson)
Entwickelten die Politeness-Theorie, die sich mit Höflichkeitsstrategien in der Kommunikation befasst und zeigt, wie Menschen in verschiedenen Kulturen Gesicht wahren.
* Hinweis zur Lesbarkeit: Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, wird im Text die männliche Form verwendet. Diese umfasst selbstverständlich alle Geschlechter.
- Egal, welches Geschlecht Sie haben.
- Egal, woher Sie kommen.
- Egal, welche Hautfarbe Sie haben.
- Egal, welcher Kultur oder Religion Sie angehören.
Bei it-sprachvermittler.de zählt einfach der Mensch.

